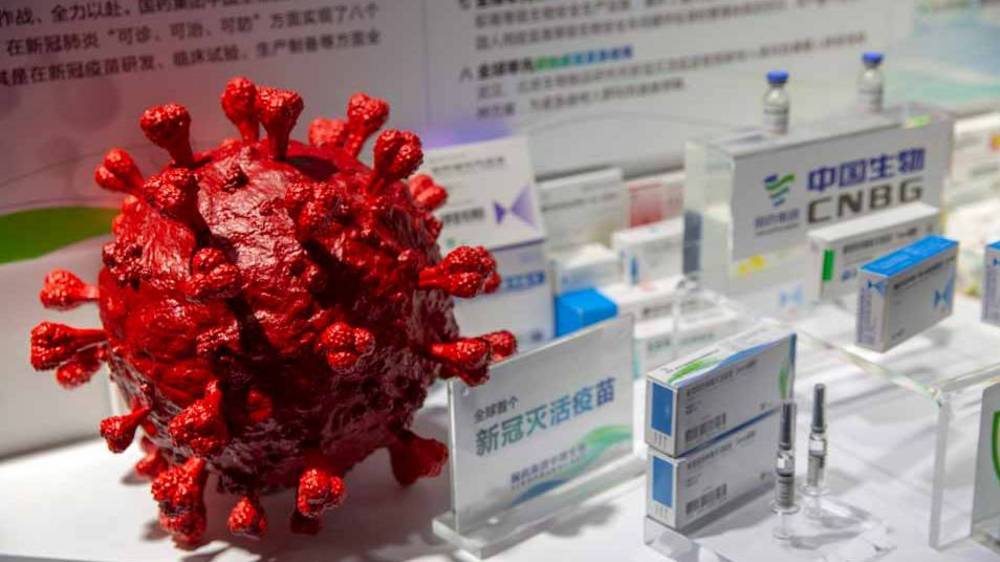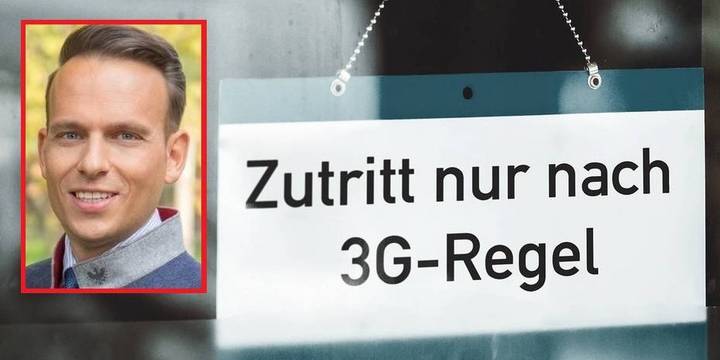Chinas Impfpolitik ‒ Eine Herausforderung für den Westen?
Chinas Impfstrategie: Impfstoffe als Gut der globalen Öffentlichkeit
Myanmar, Indonesien, Brunei, die Philippinen und nicht zuletzt Pakistan gehören zu den Nutznießern der vermeintlichen Wohltätigkeit Pekings, das diesen Ländern dutzende Impfdosen kostenfrei zur Verfügung stellt. Chinas Außenminister Wang Yi ist derzeit in Sachen Nachbarschaftspflege unterwegs, denn jüngst tourte er zu einem Besuch in Naypyidaw in Myanmar und kündigte Gratislieferung von Sinovac für das Land an, das mit steigenden Infektionszahlen zu kämpfen hat. Doch auch der indonesische Präsident Joko Widodo ist schon in den Genuss der Nachbarschaftshilfe aus Peking gekommen.
Der Moment für eine solche chinesische Nachbarschaftshilfe ist günstig, denn die USA als globaler Gegenspieler ist nach der Wahl des neuen US-Präsidenten Joe Biden und dem Sturm auf das Kapitol mit sich beschäftigt, sodass kein politisches Störfeuer aus dieser Richtung zu erwarten ist. Trotz des günstigsten Timings und des Umstandes, dass man nicht mehr behaupten kann, die asiatischen Staaten hätten die Pandemie im Großen und Ganzen gut unter Kontrolle, muss Peking besonnen vorgehen: Zum einen ist das Bewusstsein darüber, dass China das Virus überhaupt erst über die Welt gebracht hat, noch sehr präsent in den Köpfen der Menschen. Zum anderen haben sich Spannungen bei den südostasiatischen Staaten aufgebaut, die antichinesische Reaktionen begünstigen können. In Myanmar wächst beispielsweise die Angst davor, dass China seinen Einfluss so stark ausbauen könnte, dass es wie zu Zeiten der Junta isoliert ist. Überall dort, wo China übermächtig wird, wächst die Sorge in der einheimischen Bevölkerung, dass eine solche Übermacht nachteilig für sie sein könnte.
Während Samdech Hun Sen, Generalsekretär der kambodschanischen Volkspartei, die Impflieferung aus China in einem Schriftwechsel mit Xi Jinping als neuen Beleg für die Freundschaft zwischen China und Kambodscha benennt und weiter sagt, sie sei eine Förderung der umfassenden strategischen Partnerschaft und gemeinsamen Zukunft[1], so muss der diplomatische Vorstoß aus Peking, das sich der Loyalität Kambodschas sicher sein kann, in Indonesien vorsichtiger erfolgen, um keine rassistische Ressentiments gegen die chinesischstämmige Minderheit zu provozieren. Joko Widodo ist in der Bredouille, denn er braucht aufgrund der stetig steigenden Infektionszahlen die Unterstützung Pekings in Form von Impfstofflieferungen, aber eine derartige chinesische Intervention könnte auch Misstrauen in der Mehrheit provozieren, sodass seine politischen Gegner davon profitieren könnten.
Die Nachbarschaftstour des chinesischen Außenministers Wang Yi hört jedoch keinesfalls hier auf: Die Chinesen betreiben eine intensive Impfdiplomatie bei Ländern, die selber keinen starken Gesundheitssektor haben. Der Impfstoff ist also als eine politische Währung zu interpretieren. Die Konflikte um territoriale Ansprüche im Südchinesischen Meer erschweren Pekings Beziehungen zu Brunei und den Philippinen, zwei weiteren Ziele auf Wangs Nachbarschafts-Tour. Der Präsident von Manila, Rodrigo Duterte, hingegen öffnet sich für die chinesischen Impfstoffe. Er bemühte sich, den chinesischen Impfstoff, der indonesischen Tests zufolge eine Wirksamkeit von 65 Prozent haben soll, gegen jede Skepsis zu verteidigen. Duterte sucht zweifelsohne die Nähe zu Peking, was der neuen Biden-Regierung in Washington noch Probleme bereiten dürfte, wenn sie verlorenen Boden in Manila wieder gutmachen will.
Einflussnahme durchs Hintertürchen: Eine Seidenstraße der Gesundheit?
China scheint in Sachen Bekämpfung von Covid-19 sowie in Sachen Impfstoff die Nase stets vorne zu haben: Während die Pandemie im März 2020 in Europa angekommen ist und erste Lockdowns verhängt werden, startet China Mitte März den weltweit ersten Corona-Impfversuch überhaupt. Die chinesischen Unternehmen haben innerhalb von vier Wochen einen vorläufigen Impfstoffkandidaten gefunden. Zwei weitere Hersteller von Impfstoffen sollen zeitnah folgen. Bereits im Herbst, als die zweite Covid-19-Welle in Europa anrollt, sind im Reich der Mitte unzählige Beamte, Militärs und angehörige der systemrelevanten Sektoren mit dem Impfstoff des Pharmaproduzenten Sinopharm geimpft. Chinas gegenwärtiger Vorteil ist, dass es Covid-19 im eigenen Land durch sehr strikte Maßnahmen unter Kontrolle bekommen hat und somit kein großer Bedarf an Impfstoffen besteht. Europa hingegen leidet seit Beginn der Pandemie unter inneren Uneinigkeiten, einer langsamen und lähmenden Bürokratisierung sowie organisatorischer Probleme. Die Präsidentin der europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, spricht von Fehlern beim Bestellen der Impfdosen während Chinas Impfstoffhersteller von bis zu 1,5 Milliarden Impfdosen sprechen, die 2021 produziert werden könnten. Auf Basis dieser Kapazitäten hat China bereits Verhandlungen mit 14 Ländern aufgenommen, in denen der Impfstoffe angewandt werden sollen: Malaysia, Brasilien und die Türkei, die vom Westen während der Krise scheinbar im Stich gelassen worden sind, gehören zu den Verhandlungspartnern. Die westlichen Länder reservieren im Alleingang den Impfstoff und sind damit, wie die Aussage der Präsidentin der Europäischen Union beweist, wenig erfolgreich.
Das Reich der Mitte hingegen kam bereits zwei Monate nach seinen ersten Impftests, im Mai 2020, auf die WHO (World Health Organisation) zu und Xi Jinping, der chinesische Staatschef, verkündete, sein Land werde seinen Impfstoff als globales Gut zur Verfügung stellen. Im Oktober trat das Reich der Mitte der COVAX-Initiative der WHO bei, die gewährleisten soll, dass auch benachteiligte Länder im Wettbewerb um gute Impfstoffe berücksichtigt werden; eine Initiative, der Russland und die USA beispielsweise nicht angehören. Die COVAX-Initiative stellt sicher, dass alle 189 beteiligte Länder Impfstoff proportional zu ihrer Bevölkerungsmenge bekommen. Auf diese Weise wird der Angst der strukturschwächeren Länder, der Westen könne sie bei der Verteilung von Impfstoffen benachteiligen, entgegengewirkt. Leider hapert es an der Umsetzung des Plans, der auf dem Papier erstmal schön aussieht, denn COVAX konnte bisher nicht die nötigen Gelder (35 Milliarden US-Dollar) zur Umsetzung aufbringen. Aus diesem Grunde fokussiert sich China stattdessen auf bilaterale Verträge, bei denen afrikanischen, lateinamerikanischen und südostasiatischen Ländern Kredite für den Erwerb von Impfstoffen gewährt werden. Die meisten von ihnen können auf Unterstützung hoffen, weil sie sich für die Durchführung von Impfstoffversuchen angeboten haben.
Die Vertragskonditionen dieser Deals sind wenig transparent, aber klar ist, dass sie die beteiligten Länder in ein Abhängigkeitsverhältnis mit China bringen, welches deutlich über gesundheitspolitische Fragen hinausgeht. Dennoch sehen sich viele von diesen Staaten in einer Zwangslage gefangen: Impfstoff aus Europa oder den USA können sie nicht zuverlässig erhalten. Es bleiben ihnen nur zwei Alternativen: Der russische Impfstoff "Sputnik V", der bereits von Mexiko, Kasachstan und Indien gekauft worden ist, oder der Impfstoff der Chinesen. Für den Nahen Osten ist China derzeit der einzige Impfstoffgarant. Chinas Impfstoff garantiert auch zukünftig enge wirtschaftliche Verbindungen: Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Kuwait und Saudi-Arabien sind auf den Exporthandel mit China angewiesen. Auf beiden Seiten gilt es den politischen Preis des gegenseitigen Nicht-Einmischens in innere Angelegenheiten zu zahlen.
Es sei jedoch angemerkt, dass die Covid-19-Pandemie als Katalysator für eine Idee dient, die auf dem Papier schon lange vor dem Ausbruch der Pandemie existierte, aber zuvor noch nicht Fuß fassen konnte: Es handelt sich dabei um das Konzept der sogenannten "Seidenstraße der Gesundheit", die vordergründig dazu dient, ein Ende der Pandemie zu beschleunigen. Allerdings ist die "Health Silk Road" (HSR) ein Bestandteil von Chinas "One Belt, One Road"-Initiative, deren Ziele von China bereits 2015 in einem Aktionsplan beschrieben worden sind[2]. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um die ursprüngliche Seidenstraße. Die Basis der Pandemie- bzw. Impfpolitik Chinas im Ausland ist das interkontinentale Handels- und Infrastrukturnetzes zwischen China und über 60 weiteren Staaten. Häfen, Seidenstraßenkorridore und logistische Knotenpunkte konnten für die Lieferung medizinischer Hilfsgüter genutzt werden. 120 Länder wurden im Frühling über diese bestehenden Transportwege mit notwendigen Materialien beliefert. 2017 unterzeichneten 30 Staaten im Rahmen des "Belt and Road Forums" zum Thema gesundheitliche Kollaboration, ein "Health Silk Road"-Kommuniqué mit China. Dieses HSR-Kommuniqué beinhaltete nicht automatisch ein multinationales Forum, denn Chinas Interessen stehen im Fokus. Es handelt sich demzufolge um ein Potpourri aus bilateralen Verträgen, die allesamt den chinesischen Interessen dienen. Zwar haben sich zahlreiche Länder durch wirtschaftliche Interessen dazu überzeugen lassen, sich an Chinas "One Belt, One Road"-Initiative zu beteiligen, aber die Gesundheitspolitik scheint für souveränen Staaten ein Sektor zu sein, der hochgradig sensibel ist und den sie selbst verwalten wollen. Aus diesem Grund waren die Staaten bemüht sich in dieser Hinsicht das Zepter nicht aus der Hand nehmen zu lassen. Vor diesem Hintergrund hat China die HSR (Health Silk Road) wieder ganz oben auf die Liste seiner Prioritäten gesetzt und viele Länder, die sich zuvor dem chinesischen Einfluss auf ihren Gesundheitssektor entzogen haben, waren aufgrund der pandemischen Notsituation dazu gezwungen, sich auf die HSR und damit in gewisser Weise auch auf die "One Belt, One Road"- Initiative einzulassen. Länder, die die chinesische Unterstützung in Form von Impfstoffen angenommen haben, sind indirekt dazu verpflichtet, dem Reich der Mitte eine Art Persilschein für die Bereiche Wirtschaft und Politik zu geben. Wenn man so will, hat China einen Weg gefunden, indirekte ein Netz aus Satellitenstaaten zu spinnen. Kein Zweifel: China nutzt die Coronakrise gekonnt zu seinem Vorteil und um wirtschaftliche und politische Allianzen zu schmieden. Erst kürzlich unterschrieben China und 14 anderen Staaten der asien-pazifischen Region das RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), das weltweit größte Freihandelsabkommen[3].
Geopolitische Auswirkungen: Wankt die EU?
Kürzlich äußerte sich der österreichische Kanzler Kurz dahingehend, dass die europäische Impfpolitik in ihrer derzeitigen Form dazu führen werde, dass der Impfstoff in Europa sehr ungleich verteilt sein wird, da Länder wie beispielsweise Lettland hinter anderen zurückbleiben[4]. In der Tat lässt das Chaos in der EU hinsichtlich der Impfstoffbestellungen sowie der Skandal um Nebenwirkungen des Impfstoffes von Astrazeneca ein Vakuum entstehen, das China nur allzu gerne ausfüllen würde, denn schon zu Beginn der Pandemie in Europa war es bemüht, sein Image als das Land, in dem das Virus entstanden ist, auszubügeln und vor allem In Italien medienwirksame Unterstützung zu leisten. Allerdings bestand diese Unterstützung oftmals aus defekter Schutzausrüstung oder unzureichenden Mund-Nasen-Masken. Aufgrund dieser "Mängel" in der Unterstützung ist China bemüht das Bild durch das Anbieten seiner Impfstoffe als globales Gut wieder gerade zu rücken. Die Corona-Pandemie bringt generell, aber besonders im Punkt Impfstrategie, Probleme in der europäischen Politik zum Vorschein, denen es entgegenzuwirken gilt.
Generell ist es so, dass Chinas Impfpolitik dazu beiträgt, die ohnehin schon starke globale Präsenz der Großmacht nur noch mehr zu stärken. 50 Prozent der weltweiten Schutzausrüstungen wurden bereits vor der Pandemie in China gefertigt. Auch was die Covid-Impfstoffe angeht ist das Reich der Mitte schon lange an vorderster Front mit dabei, wobei angemerkt werden muss, dass es dabei natürlich nicht internationale oder westlichen Standards, sondern lediglich die eigenen Normen, einhält. So wurde in China Impfstoff bereits produziert und exportiert als dieser noch gar nicht die 3. und besonders kritische Testphase mit finalen Testergebnissen durchlaufen hatte. Eine Strategie, die auch Chinas Gegenspieler Russland verfolgt hat. China ist im Rahmen des globalen Impfstoff-Wettrennens als aktiver Player zu betrachten, der westliche Machtverhältnisse – das Machtgefüge Europa eingeschlossen – in Frage stellt. Die Fragen, die sich stellen und denen es sich in Brüssel zu stellen gilt, sind: Warum fehlte es, auch in Europa, so lange an konkreten Impfstrategien? Wie kann es sein, dass die westlichen Industrieländer immer noch in der Bekämpfung des Virus hinterherhinken? Und: Welche Botschaft sendet der Westen an all diejenigen Staaten, die sich auf den Impfstoff-Deal mit China eingelassen haben? Sie sehen in den USA und Europa bedeutende Staaten, die untereinander einen schon lange nicht mehr verdeckt ausgefochtenen Kampf führen, um sich selbst mit Impfstoffen abzusichern, dabei ist für nationalstaatliche Denke im globalen Wettbewerb um Impfstoffe kein Platz. Zumal es den südostasiatischen Staaten aus Ermangelung an Alternativen immer schwerer fallen dürfte, sich komplett dem chinesischen Einfluss zu entziehen. Da die meisten Impfstoffe eine vollständige Immunität gegen das Virus erst bei mehrfachem Nachimpfen garantieren, werden höchstwahrscheinlich dauerhafte Abhängigkeitsverhältnisse zwischen China und den Partnerländern entstehen. Während China seinen Einfluss in der Region und darüber hinaus erweitert, scheint der Westen kaum mehr präsent zu sein.
Die asiatische Ära beginnt auch in Europa, denn Italien war das erste G7-Land, das mit China eine Erklärung zur Zusammenarbeit im Kontext der Seidenstraße unterzeichnete[5]. Die chinesische Corona-Unterstützung könnte Italien dazu bewegt haben, auch zukünftig bei anderen wirtschaftspolitischen Projekten auf der chinesischen Seite zu stehen. Tatsächlich stellt die chinesische Strategie zur Bekämpfung der Pandemie sowie seine Impfpolitik das europäische System sowie, ein Stück weit, die europäische Idee selbst in Frage: Lähmende bürokratische Prozesse, Grenzschließungen und Abschottung sowie die Uneinigkeiten der Mitgliedsstaaten verstärken das Bild eines schwachen Systems, das im Gegensatz zu China nicht aus Autoritarismus und Einheitspartei besteht. Obwohl die Coronakrise die Schwachstellen Europas enthüllt hat, entbehrt die Debatte um die gemeinsame Strategie und Impfpolitik weiterhin jeden Konsens und jedweder Solidarität.
Allerdings sollte diese chinesische "Herausforderung", die sicherlich nicht die letzte gewesen sein wird, als Chance für Europa begriffen werden: Ein Europa, dass es schafft, seine Schwachpunkte auszumerzen und das mit Eintracht auftritt, kann sich der Herausforderung sicherlich stellen. Aus diesem Grund muss das Offenlegen der europäischen Schwächen als Möglichkeit begriffen werden.