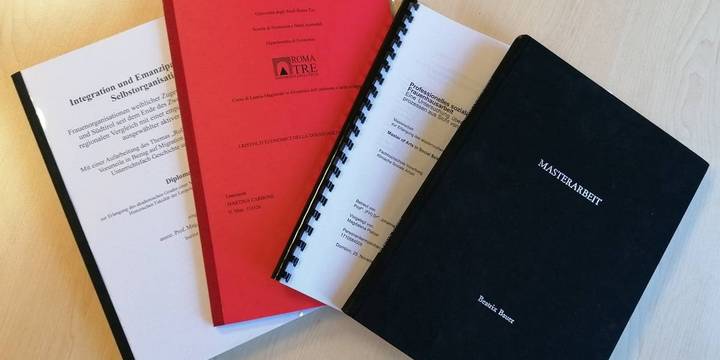Nikoläuse demonstrieren für faire Schokolade
Schokolade macht Menschen im Globalen Norden beim Essen glücklich, nur selten aber die Kakaobauern und -bäuerinnen in Äquatornähe. In westafrikanischen Ländern wie Elfenbeinküste und Ghana sind 90 Prozent der kleinbäuerlichen Betriebe vom Kakaoanbau abhängig. Das Einkommen der Bauern und Bäuerinnen in der Elfenbeinküste beträgt beispielsweise nur einen halben Euro pro Tag und liegt weit unter der Armutsgrenze, die mit zwei Euro täglich beziffert wird. Für ein existenzsicherndes Einkommen der Anbauenden müsste sich der Kilopreis der Kakaobohne auf 4,5 Euro vervierfachen.
Das niedrige Einkommen führt zu Verletzungen von Menschen- und Arbeitsrechten, sagt Rudi Dalvai, Vorsitzender des Weltladens Bozen. Rudi Dalvai war von 2011 bis 2019 Präsident der WFTO. Die World Fair Trade Organization vereint 412 Produzent*innenorganisationen, Importeur*innen und Einzelhändler*innen des Fairen Handels in 76 Ländern der Erde und ist das einzige globale Netzwerk, das sich aus Akteur*innen entlang der gesamten Fair-Handels-Wertschöpfungskette zusammensetzt. „Für die Großkonzerne ist Profit oberstes Ziel, Fairness spielt keine Rolle“, sagt Rudi Dalvai, der viele Kakaoproduzenten aus dem Fairen Handel kennt. Den Kakaogemeinschaften fehlen vielfach Grundinfrastrukturen wie Straßen, Schulen und Krankenhäuser, erklärt er. Das niedrige Einkommen erlaube es den Plantagenbesitzer*innen nicht, ihren Kakao-Baumbestand zu erneuern. Junge Menschen sehen im Kakaoanbau keine Zukunft mehr und wandern in die Städte ab. Kinderarbeit ist im Kakaoanbau vor allem an der Elfenbeinküste weit verbreitet: Rund 150.000 Kinder müssen unter schwierigsten Umständen arbeiten. Oft werden Kinder aus den Nachbarstaaten Burkina Faso und Mali gekauft oder entführt und zur Arbeit auf den Plantagen gezwungen: Ihre Zahl wird auf 20.000 geschätzt.
Globalisierung vergrößert die weltweiten Missstände: "Die reichen und wirtschaftlich starken Länder können sich aussuchen, wo sie ihre Waren einkaufen und beeinflussen die Preise für die Kakaobohne", sagt Rudi Dalvai. Oft werden die Preise so stark gedrückt, dass die Produzent*innen nichts verdienen.
Anders ist es beim Fairen Handel. Dieser will die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen am Anfang der Lieferkette verbessern und ihre politische und wirtschaftliche Position stärken. Fair gehandelte Nikoläuse und Schokolade in den Südtiroler Weltläden bieten daher eine Alternative zum konventionellen Handel. Auch in vielen Supermärkten wird inzwischen fair gehandelte Schokolade angeboten. Nikoläuse aus dem Fairen Handel sind am Siegel erkennbar, das dafür sorgen soll, dass der Schokoladenkonsum im Norden in den kakaoproduzierenden Ländern im Globalen Süden keine unzumutbaren Arbeitsverhältnisse verursacht.
Da menschliche Nikoläuse corona-bedingt heuer nicht demonstrieren dürfen, haben die schokoladigen Nikoläuse in den Südtiroler Weltläden selbst demonstriert. Es ist die wohl süßeste Demo, die es in Südtirol je gab. Mit Slogans wie "There is no chocolate B" oder "I want a hot chocolate and not a hot planet" haben die Nikoläuse bei ihren Plakaten für "Chocolate for Future" Anleihe bei den Jugendlichen von Fridays for Future genommen und verweisen damit gleichzeitig auf die enge Verknüpfung zwischen dem Einsatz für Umwelt und Gerechtigkeit. Faire Nikoläuse sind eine Alternative zu den Nikoläusen im konventionellen Handel.