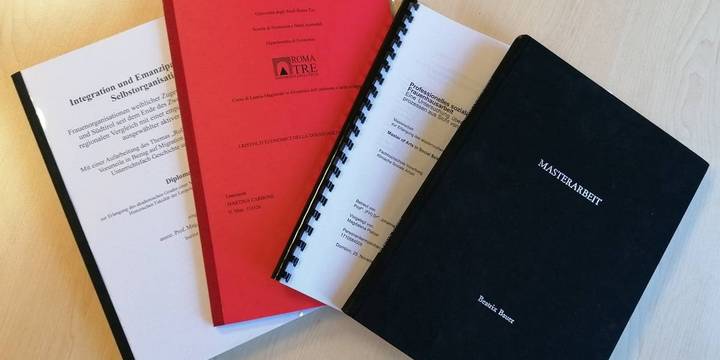Der Krieg als Entertainment - die Folgen des Krieges

Eine unserem Zeitgeist widerspiegelnde Gefahr, besteht in der schnellen Informationsvermittlung und dem Drang, reißerische Inhalte zu verbreiten. Viele Menschen verspüren das Bedürfnis, Videos zu konsumieren. Lustiges, emotionales, trauriges, brutales.
Hierbei dient die Verbreitung der Gewalt- und Kriegsvideos nicht zentral der wichtigen Informationsvermittlung, sondern insbesondere der Unterhaltung, dem Entertainment.
Der Krieg als Konsumgut
Über TikTok, Instagram und weiteren Plattformen verbreiten sich viral Videos von Bombenanschlägen, zerberstenden Häusern und sterbenden Menschen.
Während bis tief in die Corona-Pandemie Katzenvideos noch zur gesellschaftlichen Erheiterung (und zur Überlastung des Datenverbrauchs) beitrugen, reicht das nicht mehr aus, den gesellschaftlichen Drang nach Neuem, interessantem und reißerischem zu befriedigen. Die Folge daraus ist die tägliche Konsumation von Gewalt- und nun eben auch Kriegsvideos, die eine noch nie dagewesene Intensität erfahren.
Die brutalen Videos von Krieg, Brutalität und Tod treffen dabei insbesondere eine verletzliche Gesellschaftsschicht vollkommen ungefiltert: unsere Jugend.
Ralph Schliewenz, Vorstandsmitglied der Sektion Klinische Psychologie des Berufsverbands Deutscher Psycholog/innen erklärt aus wissenschaftlicher Sicht, dass Gewaltvideos wie eine Psychodroge agieren, sie manipulieren die Gefühle und Empfindungen der Jugendlichen.
Daraus kann sich einerseits ein Konsumrausch einstellen, immer mehr solcher Videos zu konsumieren. Andererseits stumpfen Jugendliche dabei teilweise ab und betrachten die Gewalt an sich enthemmter und desensibilisiert.
Das Geltungsbedürfnis
Ein weiteres Problem besteht im Geltungsbedürfnis vieler Menschen, auch Jugendlicher, welche aufgrund der neuen Plattformen eine nie dagewesene Dimension erreicht. Klicks und Views dienen dabei als neue Währung unseres Wohlbefindens. Verbreite ich ein Video, muss es von möglichst vielen Menschen angeklickt werden.
Der Selbstwert vieler Jugendlicher definiert sich maßgeblich durch das Erreichen einer vierstelligen Viewer-Zahl, also Sichtungen.
Dieses Geltungsbedürfnis der einen, gepaart mit dem Gräuel des Krieges und dem Genuss der anderen, einen erwünschten Zustand der Empörung zu erlangen, ergibt ein explosives Gemisch. Eine Abwärtsspirale, in der Jugendliche dem Drang, immer mehr davon konsumieren zu müssen, nachgeben.
Eindämmung des Konsums und Schaffung eines Kontextes
Unsere Jugend darf nicht zu willfährigen Konsumenten des Krieges werden und es obliegt unserer Gesellschaft, hier klare Grenzen zu ziehen.
Wie erreichen wir also Jugendliche, die bereits eine Abhängigkeit von den beeindruckenden Bildern des Krieges verspüren?
Ausgehend davon, dass Jugendliche diese Inhalte teilweise ungefiltert oder ohne einen beliebigen Rahmen konsumieren, ist es von Bedeutung, einen solchen zu schaffen.
Jugendliche benötigen einen Kontext, innerhalb dessen auch bedenkliche Inhalte erklärbar sind und von ihnen verständlich eingeordnet werden können. Dabei eignen sich anonyme Quellen im Internet genauso wenig wie Benzin als Löschmittel für Feuer (es wird nur schlimmer).
In erster Linie sind somit die Eltern angesprochen.
Die Schaffung eines Rahmens ermöglicht es, die notwendige Sensibilität für die Materie und damit auch Empathie für die Opfer zu vermitteln. Dies ist ein wichtiger Aspekt, um den wir uns kümmern sollten. Eltern müssen (und dürfen) nicht jeden Schritt kontrollieren, den Jugendliche online gehen. Doch wie einem kleinen Kind erklärt werden muss, wann es die Straße bei einer Ampel überqueren darf, so brauchen auch Jugendliche einen entsprechenden Kontext, um in den Weiten des Internets emotional nicht überfahren zu werden.
Das Internet ist neben der sinnvollen und vernünftigen Information gespickt mit Halbwahrheiten, verschrobener Sichtweisen, politischer Manipulation (vgl. russische Einflussnahme bei ausländischen Wahlen) und Verschwörungstheorien. Corona befeuerte insbesondere die Verschwörungstheorien und wie so oft kommen Politik und bestimmte ethnische Gruppierungen besonders schlecht weg.
Die destruktive Fehlinformation kann in einem durchaus überzeugenden Gewand daherkommen und erfordert daher einen gesunden Rahmen, innert dessen dieser sich einordnen lässt. Dies betrifft freilich auch Videos von Gewalt, Brutalität und sterbenden Menschen, die nachhaltig auf die Psyche der Jugendlichen Wirken können.
In zweiter Linie ist das Bildungssystem angesprochen.
Unsere Bildungseinrichtungen haben den gesellschaftlichen Auftrag, Schülerinnen und Schüler zu mündigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten zu entwickeln. Die Schule vermittelt Bildung, Wissen, Fähigkeiten und auch unsere gesellschaftspolitischen Werte.
Damit tragen sowohl die Eltern als auch die Schulen die Verantwortung für die Bildung und Erziehung unserer Kinder und Jugendlichen.
Die praktische Sichtweise aus der Arbeit mit Jugendlichen
Von Besay Mayer, Leiter der offenen Jugendeinrichtung "JunGle" Meran und Erika Pfeifer, pädagogische Mitarbeiterin des "JunGles".
Wir haben während unserer Arbeit im Jugendzentrum "JunGle" klar wahrgenommen, dass die Jugendlichen den Krieg in der Ukraine im "Metaverse" miterleben und sich mitreißen lassen von den Videos, die teilweise in Echtzeit übertragen werden. Für manche junge Menschen ist der Krieg eine "spannende" Abwechslung zur Corona-Langeweile, manche sagen sogar sie würden gerne selbst ins Kriegsgebiet an die Front.
Ein Beispiel dazu: ein Jugendlicher erzählt, wie er gesehen hat, dass eine Gruppe 14-Jähriger einen russischen Panzer gestohlen hat und wie aufregend das ist. Wir Erwachsene sehen nur einen Bruchteil von dem was unsere Jugend konsumiert, wie sie die Eindrücke aufnehmen und damit umgehen.
Wen hat unsere Jugend als Gesprächspartner?
Wir empfehlen den Eltern den Ukraine-Konflikt aktiv in der Familie anzusprechen und die komplexen geopolitischen Zusammenhänge zu beleuchten, damit der Krieg von den Jugendlichen nicht so oberflächlich erlebt wird. Wir fordern zudem die Schulen auf, sich jetzt weniger mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sondern sich gemeinsam mit den Schülern auch mit diesen gegenwärtigen Themen auseinanderzusetzen und darüber zu reflektieren; den Lehrern sollte dafür Zeit zur Verfügung gestellt werden.